Es war so recht ein Thema für das alljährliche Sommerloch, was jüngst Boulevardmedien, aber auch seriöse Blätter und Sender auf dem stets fruchtbaren Feld der Geheimdienstlegenden abzugrasen versuchten. Ein russischer Spionagering habe sich in den USA etabliert, hieß es. Allerlei milieugerechte Spekulationen wurden dazu – zumeist ohne jeden belastbaren Beweis – verbreitet, und vor allem konnte niemand schlüssig erklären, wozu der ganze Aufwand dienen sollte. Die Regierungen in Moskau und Washington, die sich gerade um eine Verbesserung ihres Verhältnisses bemühten, machten dem Spuk – ganz anders als in früheren Zeiten des »Kalten Krieges« – schnell ein Ende, und heute ist der vermeintliche »Skandal« fast schon vergessen.
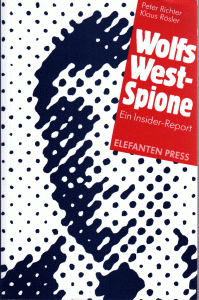 Dennoch; in der Regel sollte man bei Geschichten, die sich um Geheimdienste drehen, nicht allzu schnell zur Tagesordnung übergeben, denn bei ihnen ist in der Regel außerordentlich unklar, was Sein und was Schein bedeuten. Schließlich gehört es zum Geschäft der Spionage, sich zu verstellen, zu täuschen, anderen ein X für ein U zu machen – und was heute unlogisch, gar sinnlos erscheint, kann morgen in ganz anderem Licht stehen, plötzlich als genialer Schachzug aufgefasst werden.
Dennoch; in der Regel sollte man bei Geschichten, die sich um Geheimdienste drehen, nicht allzu schnell zur Tagesordnung übergeben, denn bei ihnen ist in der Regel außerordentlich unklar, was Sein und was Schein bedeuten. Schließlich gehört es zum Geschäft der Spionage, sich zu verstellen, zu täuschen, anderen ein X für ein U zu machen – und was heute unlogisch, gar sinnlos erscheint, kann morgen in ganz anderem Licht stehen, plötzlich als genialer Schachzug aufgefasst werden.
Gerade die Hauptverwaltung Aufklärung der DDR hat – auch geschuldet durch die konkrete historische Situation, in der sie agierte – diesbezüglich zahlreiche Beispiele »kreativer« Geheimdienstarbeit geliefert; sie sind zum Teil in einer früh erschienenen Darstellung der Geschichte und Arbeitsweise der HVA, die im Handel nicht mehr erhältlich ist, beschrieben – im Buch »Wolfs West-Spione. Ein Insider-Report«, veröffentlicht 1992 im Berliner Verlag ElefantenPress. Im folgenden der zweite Teil:
Der doppelte Mann
Ernst Lemmer ließ sich nicht lange bitten. Der CDU-Politiker, der in der Sowjetischen Besatzungszone seine Karriere begonnen hatte und nun im Vorstand der Westberliner Union saß, liebte den Plausch mit interessierten Zuhörern. Im Ratskeller des Schöneberger Rathauses plauderte er über die Lage in seiner Partei. Differenzen zwischen ihren Flügeln, politische Pläne und Perspektiven, aber auch über Gedankengänge der westlichen alliierten Kommandanten. Mit am Lemmer-Stammtisch saßen ein Arzt aus dem Ostberliner Bezirk Weißensee und ein Kleinunternehmer aus Wedding. Beide würden noch am Abend Bericht erstatten -getrennt und ohne voneinander zu wissen. Empfänger ihres Reports: das Institut für wirtschaftswissenschaftliche Forschung.
So unspektakulär waren die Anfänge der Arbeit des DDR-Spionagedienstes. Man ging dorthin, wo die Informationen noch ziemlich spontan flössen und versuchte so viel wie möglich mitzubekommen. Westberlin war dafür ein ergiebiges Pflaster, aber auch nach Bonn fuhren Späher, um sich im Umfeld der Regierungsgebäude, Botschaften und alliierten Einrichtungen Informanten zu suchen. Und die Vertreter der führenden BRD-Parteien fanden damals auch wenig dabei, mit Abgesandten aus dem Osten wenigstens inoffiziell zu verkehren; für etliche gehörte es geradezu zum guten Ton, über einen entsprechenden Draht in den Osten zu verfügen. Ehemalige Offiziere der Hitler-Wehrmacht, die in sowjetische Kriegsgefangenschaft geraten waren und dann aktiv im »Nationalkomitee Freies Deutschland« mitgearbeitet hatten, suchten alte Gefährten in der Bundesrepublik auf und erfuhren, wie man im Westen über die Wiederbewaffnung dachte. Degussa-Ingenieure oder Chemiker der ostdeutschen Betriebe schauten bei Bekannten im Ruhrgebiet vorbei, um zu hören, auf welche Weise und mit welchem Programm das »Wirtschaftswunder« anlief. Auf den ersten internationalen Messen in Wien, Leipzig oder Brno wurden Kontakte zu Messeorganisatoren und Ausstellern hergestellt, die in den Jahren darauf viel Interessantes über politische und ökonomische Entwicklungen in ihren Ländern zu berichten wussten. In jenen Jahren konnte mancher Aufklärer ein fast persönliches Verhältnis zu seinem unwissentlichen – mitunter aber sogar wissentlichen – Informanten herstellen.
Und das galt nicht nur für Gespräche, die in aller Öffentlichkeit verliefen, sondern auch für interne Kontakte, bei denen einiges über den Tisch ging, das auch nach damaligen Maßstäben eigentlich unter Verschluss bleiben sollte. Die schon skizzierte politische Entwicklung in Deutschland mit ihren Widersprüchen und besorgniserregenden Aspekten auch auf westlicher Seite machte es manchem leicht, sich über seine Verunsicherung auszusprechen. Wer nach einer politischen Alternative zu den Restaurationserscheinungen in der Bundesrepublik suchte oder wer einfach nur dem anderen deutschen Staat eine faire Chance geben wollte, war zur Lieferung von Informationen ohne jeden Druck, auf absolut freiwilliger Basis bereit. Am Rande von Verwandtenbesuchen und auch offiziellen politischen Gesprächen vollzog sich ein informeller Nachrichtenfluss, und dieser wurde oft noch dadurch begünstigt, dass die Abgrenzung zwischen den beiden Staaten noch nicht so krasse Formen wie später angenommen hatte, dass ja schließlich »Deutsche mit Deutschen« sprachen.
Journalisten, die auf Profilierung bedacht waren, streckten ihre Fühler aus und lieferten manche Information, für die sie auf entsprechende Gegenleistung hoffen konnten. All das trugen die Aufklärer zusammen und filterten ein zutreffendes Bild über die politische Situation in Deutschland heraus.
Die sowjetischen KGB-Leute beneideten ihre deutschen Kollegen nicht selten ob dieser guten Bedingungen, die infolge der offenen Grenze auch für das Verbindungswesen galten. Gleichzeitig aber erhöhten sie ihre Forderungen nach zuverlässigen Informationen und konnten damit schon von den Anfangserfolgen von IWF und H VA gehörig profitieren.
Doch Markus Wolf und seine Mitarbeiter dachten nicht nur an den gegenwärtigen Tag. Sie entwickelten bald eine langfristige Strategie für die Zukunft, die bis in die jüngste Zeit hinein wirkte. Dabei erfanden sie durchaus nichts Neues, sondern besannen sich auf den Kern jeder Spionagetätigkeit, der sich mit den drei Begriffen Herauswerben, Einschleusen und Abschöpfen umschreiben läßt. Diese drei Grundmethoden wurden durch die H VA lediglich generalstabsmäßig eingesetzt und dabei immer weiter perfektioniert.
Dies begann damit, dass vielleicht nicht bewusst, aber ansonsten gänzlich ungerührt die ersten negativen Resultate der Politik der SED in der DDR ausgenutzt wurden. Denn schon in den 50er Jahren, vor allem nach dem 17. Juni 1953, setzte ein Übersiedlerstrom aus der DDR nach Westberlin und ins Bundesgebiet ein. Schnell erkannte die HVA die damit verbundenen operativen Möglichkeiten. Nicht wenige dieser Umsiedler konnten sich nämlich sehr effektvoll als politische Flüchtlinge darstellen; andere zogen bald Profit aus der Wirtschaftswunderzeit. Solche Möglichkeilen der beruflichen und sozialen Eingliederung wurden bewusst genutzt, indem einige der fähigsten inoffiziellen Mitarbeiter (IM) der HVA den Auftrag erhielten, mit geeigneter Legende in den Westen zu gehen und sich dort – mit Hilfe von Verwandten und soweit möglich auch der Zentrale – eine Existenz aufzubauen, die später für Spionagetätigkeit auswertbar war. So gelang es, einige der Spitzenquellen späterer Jahre schon damals auf den Weg zu schicken. Die bekanntesten wurden wohl Christel und Günter Guillaume, die 1956 in die Bundesrepublik übersiedelten, sich dort in der SPD bis in Positionen hochdienten, die operativ ihresgleichen suchten, und erst 1974 enttarnt wurden. Aber es gab zahlreiche weitere Spione, die als Übersiedler ihre Karriere begannen. Manche von ihnen haben bis in die 80er Jahre hinein gearbeitet, und einige werden ihr Geheimnis mit ins Grab nehmen.
Natürlich dauerte es nicht lange, bis die gegnerische Abwehr hinter diese Methode kam und sich dagegen zu schützen begann. Verwiesen sei nur auf die Notaufnahmelager, in denen durch die Geheimdienste der westlichen Alliierten, aber auch den Verfassungsschutz und den Bundesnachrichtendienst peinliche Befragungen angestellt wurden, um den Übersiedlern auf den Zahn zu fühlen.
Und auch den westlichen Abwehrleuten half die große Zahl der Übersiedler – gab es doch dadurch kaum eine Straße oder einen Betrieb im Osten, aus denen nicht Informanten ausfindig gemacht werden konnten, die über andere Auskunft zu geben vermochten.
Die Guillaumes hatten diese Klippe umschifft, indem sie ohne Lageraufenthalt sofort bei Christel Guillaumes Mutter Erna Boom in Frankfurt/Main Quartier nahmen. Manch anderer mit Spionageauftrag ausgestatteter »Republikflüchtige« aber konnte von den Organen der Bundesrepublik aufgeklärt werden, und das erwies sich als wirksames Hemmnis auf dem Weg in operativ interessante Positionen.
Dennoch hielt die HVA an der vom KGB vertretenen These fest, dass nur die eigenen Bürger gute Kundschafter seien, man sich letztlich nur auf sie zuverlässig stützen könne. Daher wurden Methoden ausgeklügelt, wie sich DDR-Bürger sicherer im Operationsgebiet bewegen könnten. Die Lösung schien: Sie müssen über Personaldokumente verfügen, die jeder Kontrolle standhalten. Das aber war nur zu erreichen, wenn bei der Überprüfung eines solchen Papiers dahinter ein völlig harmloser Bundesbürger sichtbar wurde. Und so ging man dazu über, die im Geheimdienstgeschäft schon lange praktizierte Doppelgänger-Variante nach allen Regeln der Kunst zu perfektionieren.
Immer wieder kommt es vor, dass Personalpapiere verlorengehen – durch Verunreinigung, Diebstahl, Nachlässigkeit usw. Spricht also ein Bürger bei seiner Meldestelle nach einem solchen Malheur vor, dann bekommt er zumeist ohne große Formalitäten einen neuen Ausweis ausgestellt. Voraussetzung ist allerdings, daß er über alle Daten verfügt, die zu einer solchen Antragstellung benötigt werden – für das Original kein Problem, für den Doppelgänger schon eher. Denn er muss nicht nur die Biographie der betreffenden Person genau kennen, sondern auch ihr verwandtschaftliches Umfeld, ihre früheren Wohnsitze, Arbeitsstellen und vieles mehr. Mitunter dauerte es Jahre, ehe ein Übersiedlungskandidat sein Pendant so genau kannte, dass er in dessen Haut schlüpfen konnte. Und er hatte ihn zuvor mitunter um den halben Erdball verfolgt, ja oft zu ihm selbst Kontakt aufgenommen. Solcher Aufwand lohnte natürlich nur, wenn man wüsste, dass die zu kopierende Person die Absicht hatte, die Bundesrepublik für immer zu verlassen. Wollte sie in die DDR übersiedeln – was selten genug vorkam, dann musste sichergestellt werden, dass sie einen Umzug innerhalb der Bundesrepublik vortäuschte, ehe sie die Grenze nach Osten überschritt. Am Umzugsort tauchte dann der Doppelgänger auf und übernahm die Rolle der ausgereisten Person. Bei Abmeldungen ins Ausland erwies sich der Doppelgänger als baldiger Rückkehrer, der aber – aus verständlichen Gründen – an einem anderen Ort als zuvor seinen Wohnsitz nahm. Waren derartige Absichten bekannt, dann konnte ein geeigneter Aufklärer ganz gezielt auf eine solche Doppelgängerrolle hin ausgebildet werden, was des ungeheuren Aufwands wegen jedoch nur selten praktiziert wurde.
In der Regel wurde weitaus unkomplizierter vorgegangen. Für illegale Reisen von IM aus der DDR ins Bundesgebiet genügte einfach das Duplikat des Passes eines realen bundesdeutschen Bürgers, das beim heutigen Stand der Technik relativ leicht hergestellt werden konnte. Das gilt übrigens auch für die sogenannten fälschungssicheren Ausweise, die den Technikern der HVA nur solange ein Geheimnis waren, solange sie die Technologie ihrer Herstellung nicht kannten. Natürlich durfte bei einer Reise mit solch einem Doppelgänger-Pass nichts Unvorhergesehenes passieren. Das ARD-Fernsehen schilderte einmal in einem »Tatort«-Krimi über die DDR-Spionage einen Verkehrsunfall, bei dem die Familie des Opfers über das traurige Ereignis informiert werden sollte – und da stand plötzlich der vermeintlich Verunglückte quicklebendig vor den Polizisten.
So bestechend die Doppelgänger-Variante aussieht und so gut sie sich vielleicht in einem Spionageroman macht, so problematisch ist sie jedoch für die tatsächliche operative Arbeit. Denn sie funktioniert nur, wenn die eigentliche Originalperson nicht plötzlich ins Blickfeld wie auch immer gearteter Interessenten gerät. Selbst wenn jemand nach Argentinien, Brasilien oder Uruguay ausgewandert ist, kann man nicht sicher sein, ob ein entfernter Verwandter nicht plötzlich auf die Idee kommt, Ahnenforschung zu betreiben und auch nach jenem Verwandten zu fahnden, von dem er dann überrascht erfährt, dass er gar nicht auf dem amerikanischen Subkontinent lebt, sondern nur einige Kilometer entfernt in einer deutschen Stadt. Vielleicht kommt der Betreffende auch einmal auf Besuch in seine alte Heimat und stößt auf Spuren seiner selbst aus jüngster Zeit, was ihn gewiss stutzig machen wird. Vielleicht benötigt er auch wegen Scheidung, Heirat oder aus anderen Gründen Personalpapiere, die er zu Hause anfordert, was die Meldebeamten ins Grübeln bringen dürfte.
Jede Datenerfassung – und diese haben heutzutage Konjunktur – birgt die Gefahr der Enttarnung, und es ist unmöglich, alle diese Eventualitäten unter Kontrolle zu halten. Bei wochen-, monate-, gar jahrelangen Aufenthalten in der Fremde ist es unvermeidlich, dass die so genannten kleinen Personalien ab und zu erfasst werden, und niemand weiß, was mit ihnen weiter geschieht. Zwar beschaffte die HVA regelmäßig die aktuellen Fahndungsbücher und konnte so überprüfen, ob Doppelgänger darin auftauchten. Anhand der Schlüsselnummern war sogar feststellbar, warum möglicherweise gefahndet wurde. Aber all das forderte viel Kraft, und es war immer wieder abzuwägen, ob der Aufwand für die Abdeckung nicht größer wurde als der Nutzen aus der darauf basierenden eigentlichen operativen Arbeit.
Daher wurde die Doppelgänger-Variante auch nie zur Hauptmethode der Tarnung eines IM im Operationsgebiet. Im Gegenteil, viele HVA-Mitarbeiter nutzten für ihre »Inoffiziellen« lieber fiktive Papiere. Sie waren in der Qualität der Fälschung so perfekt, dass lediglich gründliche Tiefenuntersuchungen zur Enttarnung ihres Benutzers führen konnten. Außerdem war möglich, viertel- oder halbfiktive Dokumente herzustellen, bei denen ein Teil der Angaben richtig war und nur ein anderer Teil falsch. Sie verschafften in der Regel größere Sicherheit.
Die Spionage der HVA stand in einem besonderen Zwang, immer neue Finten der Camouflage auszudenken, weil ihr andere Möglichkeiten der Beschaffung nachrichtendienstlicher Informationen lange Zeit verwehrt schienen. Alle bedeutenden Geheimdienste der Welt arbeiten mit sogenannten legalen Residenturen, d. h. speziellen Mitarbeitern, die an Botschaften, Gesandtschaften, Handelsvertretungen oder Firmenfilialen angeschlossen sind. Dadurch oft diplomatische Immunität genießend, bearbeiten diese Spione im Frack die politischen, militärischen und wirtschaftlichen Kreise des jeweiligen Gastlandes. Ein großes Risiko gehen viele dieser Aufklärungsbeamten nicht ein; sie beschränken sich oft darauf, Gesprächspartner »abzuschöpfen« und aus diesem Wissen – kombiniert mit offiziellen Erkenntnissen – dann mehr oder weniger kluge Analysen zu erarbeiten.
Aufgrund der Hallstein-Doktrin waren der DDR solche Möglichkeiten lange Jahre versagt, und sie musste sich voll und ganz auf die illegale Linie konzentrieren. Das war eine ständig neue Herausforderung vor allem an die Konspiration der Arbeit, was sich ohne Zweifel günstig auf die Professionalität und Perfektion der HVA-Operationen auswirkte. So war schon in den 50er Jahren das weltweit bekannte nicht entzifferbare Chiffriersystem auch der DDR verfügbar, in das die Abwehrorgane der Bundesrepublik letztlich nur durch Überläufer eindringen konnten und dann auch nur auf deren Wissen begrenzt blieben. Das Verbindungssystem über Funk wurde ausgebaut, und noch heute dürften – nun vielleicht schon unbrauchbar – Funkgeräte in diversen Verstecken zwischen Fehmarn und Bodensee lagern.
Unerschöpflich waren die Ideen zur Schaffung unentdeckbarer Transportcontainer (TBK) zur Materialübermittlung. Die klassische Form der Tasche oder des Koffers mit versteckten Seitenfächern oder doppeltem Boden verlor zwar nie ihre Bedeutung, doch wurden hochbrisante Materialien nicht selten auch an verborgenen, intimen Stellen des Körpers versteckt. Mit der Mikrofilmtechnik wurden die Container immer kleiner. Manschettenknöpfe oder Feuerzeuge, Puderdöschen oder Zahnpastatuben waren bald beliebte Varianten, aber auch den gegnerischen Abwehrleuten entgingen solche Möglichkeiten nicht. Zeitweilig setzte man auf Vernichtungscontainer, die belastende Beweise beseitigen sollten, indem bei unsachgemäßer Öffnung eine Brand- oder Säurekapsel zersprang und das Material zerstörte. Profis unter den Aufklärern trugen jedoch ihr Material am liebsten ganz normal bei sich, mitunter sogar offen unter dem Arm, weil man gerade das am wenigsten erwartete. Ein häufig genutztes Verfahren der Nachrichtenübermittlung waren »Tote Briefkästen« in Zügen, sogenannte Zug-TBK. Hierzu wurde der zwischen beiden deutschen Staaten recht rege Reiseverkehr ausgenutzt, indem man in Waggons der Deutschen Reichsbahn an festgelegten, unauffälligen Stellen Material deponierte, das nach der Grenzpassage entnommen werden konnte.
Eine große Rolle spielte im nachrichtendienstlichen Geschäft der HVA auch die langfristige Planung von Operationen. Sie hatte da ihren Sinn, wo sie nicht zum Dogma wurde und die unbedingt erforderliche Improvisation einschränkte. Unter den spezifischen Bedingungen der DDR stand immer dringlicher die Aufgabe, Kundschafter im Lager des Gegners selbst zu entwickeln. Einmal durch langfristige Arbeit, durch die IM in interessante Objekte der Politik (Regierung, Parteien, Großorganisationen usw.), der Wirtschaft (Verbände, Konzerne, Forschungszentren, Rüstungsbetriebe u. ä.), des Militärs (Stäbe, Kommandostellen, Kasernen) und natürlich der gegnerischen Geheimdienste eingeschleust wurden, zum anderen durch die »Herauswerbung« solcher Personen aus diesen Objekten. Für die Einschleusung wurden sogenannte Per-spektiv-IM entwickelt. Dies waren junge Leute in der Ausbildung, die bereits fest angeworben wurden und ihren weiteren beruflichen Weg immer in Abstimmung mit der Zentrale verfolgten. So wurde aus dem Physikstudenten vielleicht eines Tages der Etagenchef eines Rüstungskonzerns, aus dem Sprachschüler ein Dolmetscher auf internationalen Tagungen. Solche Perspektiv-Agenten gingen durchaus oft ihren eigenen Weg; die Kunst ihrer Führung bestand darin, die persönlichen Vorstellungen mit den Interessen der HVA in Übereinstimmung zu halten. Die Zentrale unterstützte natürlich ihren Nachwuchsmann auf seinem Weg nach oben und lenkte ihn dabei behutsam entsprechend ihren Wünschen. Das war nicht immer einfach, denn besonders private Anliegen ließen sich mit dem nachrichtendienstlichen Erfordernis oft schwer in Übereinstimmung bringen. Der Spion in spe wollte heiraten, doch die Auserwählte hatte wenig Verständnis für sein konspiratives Tun. Die Agentin wünschte sich ein Kind, schied dadurch aber für lange, wenn nicht für immer aus der operativ ergiebigen Position aus. Nicht wenige Verbindungen sind so wieder zerrissen. Gelang es aber, solche Probleme im Einvernehmen zu bewältigen, dann stärkte das wiederum die gegenseitige Beziehung, die sich möglicherweise über Jahrzehnte hin als haltbar erwies.
Ebenso erfolgversprechend, aber ähnlich langwierig war die Methode des »Herauswerbens«. Damit konnten bei Spitzenobjekten in der Regel keine ehemaligen DDR-Bürger beauftragt werden, sondern für solche Karrieren waren Leute zu finden, die eine lupenreine Vergangenheit in der Bundesrepublik hatten. Auf der Suche nach ihnen nutzte die HVA zunächst den Besucherverkehr, der sich vor allem nach dem Mauerbau am 13. August 1961 in streng kontrollierten Bahnen vollzog. Und die DDR-Aufklärung hatte vollen Zugriff auf diese Daten. In der Hauptabteilung VI des MfS wurden alle grenzüberschreitenden Bewegungen registriert und im Computer gespeichert; auf Antrag konnten dort interessierende Informationen, wie Reiseziele, Reisetermine, mitreisende Personen, Kfz-Kennzeichen und ähnliches, über einen längeren Zeitraum hin abgerufen, aber auch Aufträge erteilt werden, auf welche Personen beim Grenzübertritt besonderes Augenmerk zu richten sei. So kam es, dass schon lange vor Einreise eines West-Besuchers in den Büros der HVA nachgedacht wurde, ob sich bei ihm eine Ansprache lohne und wie man gegebenenfalls vorgehen könne. Nicht wenige Bundesbürger haben dann ja auch die Erfahrung gemacht, dass fremde, aber oft recht freundliche Herren während ihres DDR-Aufenthaltes das Gespräch mit ihnen suchten, Fast regelmäßig dürfte es sich dabei um Aufklärer der HVA – oder der Armeeaufklärung im Ministerium für Nationale Verteidigung, einer Art Konkurrenzunternehmen der Aufklärung, oder eines anderen auf dem Territorium der DDR operierenden Geheimdienstes – gehandelt haben.
Diese Methode war zwar einfach und risikolos, jedoch auch nicht sehr effektiv. Die meisten der Angesprochenen rochen den Braten und lehnten freundlich dankend ab, zumal dann, wenn der Werber allzu plump auftrat. Einige gingen – in Sorge um ihre Rückkehr in den Westen – zum Schein auf die Avancen ein, um sich dann aber sofort ihrem Arbeitgeber oder gleich dem Verfassungsschutz zu offenbaren. Und wer dennoch mitmachte – einige aus Abenteuerlust, andere vielleicht sogar aus Überzeugung, viele nur wegen des zugesagten Nebenverdienstes -, konnte zumeist nicht in die wirklich sensiblen Bereiche gelangen, die für die HVA interessant waren. Denn allein durch ihren DDR-Kontakt waren ihnen oft bestimmte Aufstiegsmöglichkeiten verbaut. Wer enge Verwandte im Osten hatte oder allzu häufig in die DDR reiste, wurde leicht als Sicherheitsrisiko eingestuft.
Gerade in den 70er und 80er Jahren haben alle westlichen Staaten ihre Sicherheitsbestimmungen auf dem Personalsektor ausgebaut. Personalfragebögen enthielten obligatorisch Fragen nach Verwandten im Osten und Reisen hinter dem »eisernen Vorhang«. Die Angaben dazu wurden peinlich genau überprüft, was die Einstellungsfristen für Bewerber erheblich verlängerte. Und an besonders schutzwürdigen Stellen wurden Sicherheitsstufen eingeführt, bei deren Erreichen wieder neue Ermittlungen begannen. Lagen die Ergebnisse vor, zu deren Überprüfung auch Bürgen befragt wurden, fand ein Gespräch statt, in dem man versuchte, vermeintliche oder tatsächliche Widersprüche aufzuklären. Solche Gespräche wurden von erfahrenen Personalarbeitern geführt und waren mit zahlreichen Fangfragen gespickt. Günter Guillaume wurde vor seiner Einstellung im Kanzleramt sogar von dessen damaligem Chef Horst Ehmke in die Mangel genommen. Diese zwei Stunden nannte Guillaume später die schwierigsten seiner Laufbahn, denn er wurde einer »Schockbefragung« (Illustrierte »Stern«) unterzogen. Der als Zeuge anwesende Geheimschutzbeauftragte des Kanzleramtes sagte später aus: »Der Herr Minister hat Herrn Guillaume mit Fragen regelrecht berannt, ohne Schonung!«
Dennoch ist es immer wieder gelungen, auch solche Hürden zu überspringen. Einmal dadurch, daß sich der Kundschafter durch entsprechendes Training auf diese Situation gründlich vorbereitet hatte und sie so überstehen konnte. Seine Selbstsicherheit, seine Anpassungsfähigkeit an die Erwartungen des Personalchefs bis hinein in Äußerlichkeiten konnten dazu beitragen. Mehr noch aber eine entsprechende Vorarbeit in der betreffenden Institution, durch die die Bewerbung auf schon vorhandenes Wohlwollen stieß. Dabei handelte es sich zumeist um die Empfehlung eines bereits dort Tätigen, möglichst mit solidem Ansehen. Diese so genannte Blickfeldarbeit war daher ein wesentlicher Bestandteil des operativen Vorgehens der HVA.
Es wurde also immer notwendiger, Werbungen künftiger Spione an Ort und Stelle, im sogenannten Operationsgebiet – für die HVA war das in erster Linie die Bundesrepublik – vorzunehmen. Dazu brauchte man qualifizierte Werber, die zunächst ausschließlich aus der DDR selbst kamen. Hier wurden sie gründlich ausgebildet, auch mit psychologischen Kenntnissen versehen, und dann oft relativ langfristig eingesetzt. Sie mussten zunächst das Zielobjekt aufklären, von der territorialen Lage bis zum Personalbestand, und dazu rekrutierten sie Kräfte aus dessen unmittelbarer Umgebung. Diese gingen noch kein sehr großes Risiko ein, sollten sie doch nicht selbst ins Objekt eindringen, sondern lediglich über den Besucher- und Postverkehr, vielleicht auch über das Dienstreiseregime und interessante personelle Fakten berichten.
Die eigentliche Arbeit begann, wenn der Werber, mit all dem angesammelten Wissen versehen, auf den Plan trat. Er nahm eine oder mehrere geeignete Personen ins Visier und begann nun seinerseits mit deren intensivem Studium. Je mehr er über seine Zielpersonen wusste, um so sicherer konnte er den Erfolg einer Werbung prognostizieren. In vielen Fällen wurde auf eine Weiterarbeit verzichtet, weil die Erfolgschancen gering waren. Dort aber, wo gute Aussichten bestanden, musste der Werber dafür sorgen, dass die Anbahnung eines Kontaktes total unverfänglich war, nicht den leisesten Verdacht erregte. Das erforderte viel Kleinarbeit, vor allem die exakte Kenntnis des Regimes im und um das Objekt, vor allem hinsichtlich der Personalfluktuation. Woher kamen neue Mitarbeiter? Wohin gingen Ausgeschiedene? Was konnten Kündigungsgründe sein? Aber auch: Wo wohnten die Angestellten? Auf welchem Wege kamen sie an ihren Arbeitsplatz, wie wieder nach Hause? Wo verbrachten sie ihre Freizeit? Gab es untereinander auch nach dem Dienst Kontakt? Wo und wie fand er statt? Zur Beantwortung solcher Fragen wurde geradezu akribisch vorgegangen. Mit Hilfe der von HVA-Aufklärern beschafften Telefon- und Adressbücher der NATO und einem Stadtplan von Brüssel konnte beispielsweise genau festgestellt werden, wo die Bediensteten des Nordatlantikpaktes konzentriert waren; ihre Wohnungen wurden auf diese Weise sogar auf der Karte markiert. Und da hinein, wo die Markierungen am dichtesten waren, pflanzte der zuständige Leiter seinen Bleistift und sagte: »Hierhin zieht unser Werber!« Damit war sichergestellt, daß er auf ganz normale Weise – in Restaurants, beim Einkauf, in Behörden – Kontakte anknüpfen konnte, die für die Sicherheitskontrolleure nichts Ungewöhnliches hatten. Das alles war natürlich sehr aufwendig, und da der Werber aus der DDR kam, letztlich doch mit dem Risiko behaftet, dass Verbindungen der Zielperson zum Osten nachgewiesen werden konnten. Relativ zeitig wurde deshalb die Methode »Werber wirbt Werber« entwickelt. Ihr Grundgedanke bestand darin, dass der Werber aus der DDR nicht unmittelbar auf ein interessierendes Objekt angesetzt wurde, sondern sich seinerseits geeignete Personen aus dessen Umfeld suchte, die dann als die eigentlichen Werber agieren konnten. Auch das setzte natürlich einen langen Aufenthalt des DDR-Werbers in der Bundesrepublik oder im Ausland voraus, wobei die Legende aber so unverfänglich war, dass er durch sie kaum in den Gesichtskreis der Abwehrorgane geriet.
Beispielsweise gelang es einem solchen Werber, vielleicht einem Lehrer aus der DDR, sich als Experte für pädagogisch wertvolles Kinderspielzeug auszugeben, der die Absicht verfolgte, mit seinen Ideen und Vorstellungen auf den europäischen Markt vorzudringen. Das ermöglichte ihm, sich am Einsatzort ein Untermieterzimmer zu nehmen und sich längere Zeit unauffällig im Operationsgebiet aufzuhalten. Nun suchte er zunächst sprachgewandte Mitarbeiter, die ihm helfen sollten, entsprechende Werbeschriften zu übersetzen. Das gelang relativ leicht, denn an Universitäten und Hochschulen gibt es viele Interessenten für Nebenbeschäftigungen – zumal dann, wenn sie gut bezahlt werden. Natürlich kam er mit solchen Bewerbern ins Gespräch, erkundete ihre Persönlichkeit, ihre politischen Einstellungen. Davon ausgehend vertiefte er bei dem einen oder anderen den Kontakt allmählich – durch die Einladung zu gemeinsamen Reisen in die damaligen sozialistischen Länder, dortige »zufällige« Begegnungen mit interessanten Personen usw. Es entstand ein Vertrauensverhältnis, das an einem bestimmten Punkt mit der Offenbarung des Werbers konfrontiert werden konnte. Das war dann erfolgreich, wenn es sich um eine im grundsätzlichen politisch gleichgesinnte Person handelte, deren Hauptmotiv für die Unterstützung der HVA ideologische Nähe zum Osten war. Die Sympathien bei vielen linksgerichteten Bundesbürgern für die politischen und sozialen Ziele der DDR waren über lange Zeit nicht unerheblich, und auf dieser Basis gelang es immer wieder, geeignete Personen zu gewinnen. Dass materielle »Argumentationshilfen« hinzutraten, ist selbstverständlich, reichte aber für die Motivierung eines solchen Werbers im Operationsgebiet in der Regel nicht aus, denn für dessen Aufgabe wurde eine bestimmte innere Anteilnahme, eigenständiges kreatives Vorgehen benötigt.
Hatte sich der Werbekandidat aus der BRD schließlich bereit erklärt, dann konnte er – von Herkunft und Entwicklung her völlig unverdächtig – damit beginnen, seinerseits gezielte Kontakte zu den Mitarbeitern des ins Auge gefassten Ministeriums, der interessierenden Bundeswehreinheit, einer Botschaft usw. herzustellen. Der Werber aus der DDR stand ihm dabei weiter beratend zur Seite, und wenn dieser seine Aufenthaltslegende in der Bundesrepublik gut abgesichert hatte, dann bedeutete das auch keine Gefahr. Zu einer solchen Absicherung genügten schon Empfehlungsschreiben von Firmen, die mit seiner vorgeblichen Tätigkeit etwas zu tun hatten. Diese wurden zumeist von ganz anderen Personen beschafft, wobei der DDR ihre Behinderung in internationalen Handelsgeschäften paradoxerweise insofern zugute kam, als mancher Unternehmer einfach aus einem Gefühl der Fairness heraus solche Erklärungen ohne weitere Prüfung zur Verfügung stellte. Der Spielzeugexperte zum Beispiel konnte auf eine rege Korrespondenz mit Partnern in Norditalien verweisen, die als Empfehlung schon ausreichte und von niemandem genauer hinterfragt wurde.
Die operativen Erfolge der DDR-Aufklärung basierten also zu einem wesentlichen Teil auf der geschickten Nutzung der politischen Situation und einer intensiven und geduldigen Kleinarbeit, die oftmals Jahre in Anspruch nahm. Allein die Etablierung eines Werbers aus der DDR konnte ein bis zwei Jahre dauern; hinzu kam die Werbung des BRD-Werbers und dessen Bemühen um die eigentliche Quelle im Objekt. Nicht selten vergingen fünf Jahre, ehe die Gesamtoperation von Erfolg gekrönt war – ein aufwendiger und daher auch nicht allzu häufig beschrittener Weg.
Die Werbung eines Aufklärers auf der Basis politisch-ideologischer Gemeinsamkeiten war gewissermaßen der Königsweg der DDR-Spionage. Er funktionierte auch so lange, wie der ostdeutsche Staat ein gewisses Ansehen genoss und er international über seine inneren Verhältnisse hinwegtäuschen konnte. Jedoch schon in den 60er Jahren wurde das immer schwieriger, und vor allem das Eindringen in wichtige Objekte der Bundesregierung, der staatstragenden Parteien, aber auch der NATO und ähnlicher Gremien verlangte immer häufiger das Vorgehen »unter fremder Flagge«. Dies bedeutete, dass der Aufklärer seinem Gegenüber einen anderen als den tatsächlichen Auftraggeber vorspiegelte. Denn mancher Beamte, mancher Angestellte einer sensiblen Behörde war zwar aus Verärgerung über bestimmte politische Entscheidungen oder gar die Grundtendenz der Politik bereit, dagegen etwas auch mit konspirativen Mitteln zu tun, nicht aber für einen östlichen Geheimdienst. Voraussetzung auch einer solchen Werbung war Kenntnis über die latente Bereitschaft einer interessanten Person, vielleicht des Attachés einer Botschaft, Interna aus dem eigenen Arbeitsbereich zu verraten – entweder aus den genannten politischen Gründen oder um sich ein kleines Zubrot zu verdienen. Politische Gründe ergaben sich meist aus Differenzen zwischen einzelnen Staaten. So bot sich Ende der 60er Jahre, als Frankreich aus der militärischen Integration der NATO austrat, dieses Thema für Werbungen »unter fremder Flagge« an. Es war einsichtig, dass sowohl die Franzosen die Auffassung ihrer Bündnispartner über diesen Schritt kennenlernen wollten als auch die Amerikaner, aber auch die Deutschen, die Engländer und andere brennendes Interesse an den Motiven und möglichen weiteren Aktionen de Gaulles hatten. Die Vorspiegelung, ein Geheimdienst aus einem dieser Länder sei um politische, militärstrategische oder auch wissenschaftlich-technische Informationen (zum Beispiel zur von Frankreich entwickelten Force de frappe) bemüht, erstaunte niemanden und bot eine günstige Voraussetzung für die Werbung. Natürlich stellt ein solches Vorgehen hohe Anforderungen, einmal hinsichtlich einer telefonischen oder direkten persönlichen Verbindung, die keinerlei Hinweis auf die DDR zulassen durfte, vor allem aber in bezug auf eine glaubwürdige Aufgabenstellung. Sie müsste sich notgedrungen auf solche Fragen beschränken, die zum Beispiel für die Bundesrepublik interessant waren, während das spezifische Informationsinteresse der DDR nur mittelbar, über diesen Umweg befriedigt werden konnte. Das verlangte sehr intime Kenntnis der französischen wie der bundesdeutschen Politik und der Besonderheiten der deutsch-französischen Beziehungen. Und dennoch war nicht auszuschließen, dass der Partner misstrauisch wurde und eigene Ermittlungen über die Person des Werbers anstellte – mit allen sich daraus ergebenden Gefahren.
Andererseits gab es in der Arbeit mit »fremden Flaggen« aber auch erleichternde Elemente. Da als Hintergrund fast immer ein Geheimdienst angegeben wurde, war für den Partner Konspiration selbstverständlich. Er fand nichts dabei, dass mit Decknamen, Deckadressen und Decktelefonen gearbeitet wurde, Treffs in Gaststätten stattfanden und Gelder bar übergeben wurden – alles Dinge, die für offizielle Kontakte nicht in Frage kamen oder zumindest ungewöhnlich waren. Überprüfungsmaßnahmen waren dadurch erschwert; der Angeworbene fast ausschließlich gezwungen, seinem Partner zu glauben. Die HVA war in ihrer Arbeit mit »fremden Flaggen« immer bemüht, einen möglichst progressiven Hintergrund zu wählen, auch wenn konservativere Kreise für die Aufklärung durch einen westlichen Geheimdienst eine oft glaubwürdigere Abdeckung boten. Doch die fortschrittlichere Variante ließ dem HVA-Werber mehr eigenen Spielraum, war ihm natürlich vertrauter als konservatives Denken – und außerdem war es leichter, von dieser Basis zu einer späteren Offenbarung des wahren Bezugspartners zu kommen. Dies war zwar immer das Ziel; es konnte jedoch meist nicht verwirklicht werden. Da, wo es dennoch gelang, entstand in der Regel eine sehr stabile, langdauernde Beziehung. Andererseits war die Methode der »fremden Flagge« aber mit einer besonderen Gefahr verbunden. Wenn der Partner zur Unzeit herausbekam, mit wem er es tatsächlich zu tun hatte, konnte es passieren, dass er sich dem Abwehrdienst seines Landes offenbarte und fortan als Doppelagent für beide Seiten arbeitete.
So bestechend also auch diese Methode zunächst aussieht, ist ihre Handhabung doch außerordentlich schwierig und verlangt vom Aufklärer nicht nur ein hohes Maß an Einfühlungsvermögen in die Denkweise seines westlichen »Kollegen«, sondern auch viel Phantasie und Flexibilität. Nicht oft ist es gelungen, diese Eigenschaften in der erforderlichen Weise zu mobilisieren, obwohl gerade in den 70er und 80er Jahren große Anstrengungen unternommen wurden, über »fremde Flaggen« an Informationen heranzukommen. Denn bereits damals war die Neigung im Schwinden, für den Nachrichtendienst eines Landes zu arbeiten, das in seiner Politik international anerkannte Grundprinzipien allzu leicht mißachtete.
Dennoch: Die professionellen Fähigkeiten der DDR-Spione führten zu einer Reihe von spektakulären, aber auch weniger bekannt gewordenen Erfolgen. Sie machten über lange Jahre den Nimbus der Hauptverwaltung Aufklärung aus und verdeckten damit die system-immanenten Schwächen und Mängel, die letztlich dazu beitrugen, dass auch dieser Dienst im Umbruch der Jahre 1989/90 zugrunde ging.